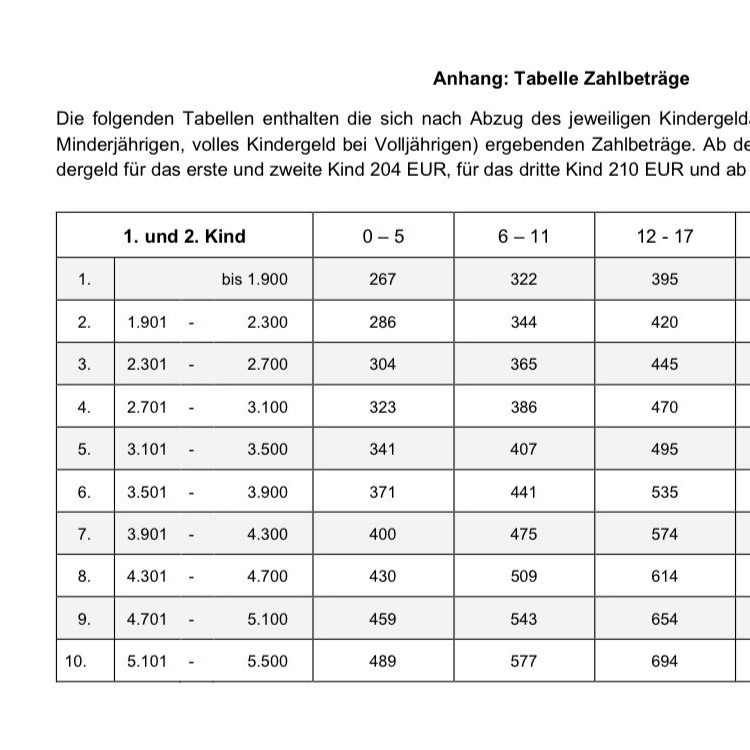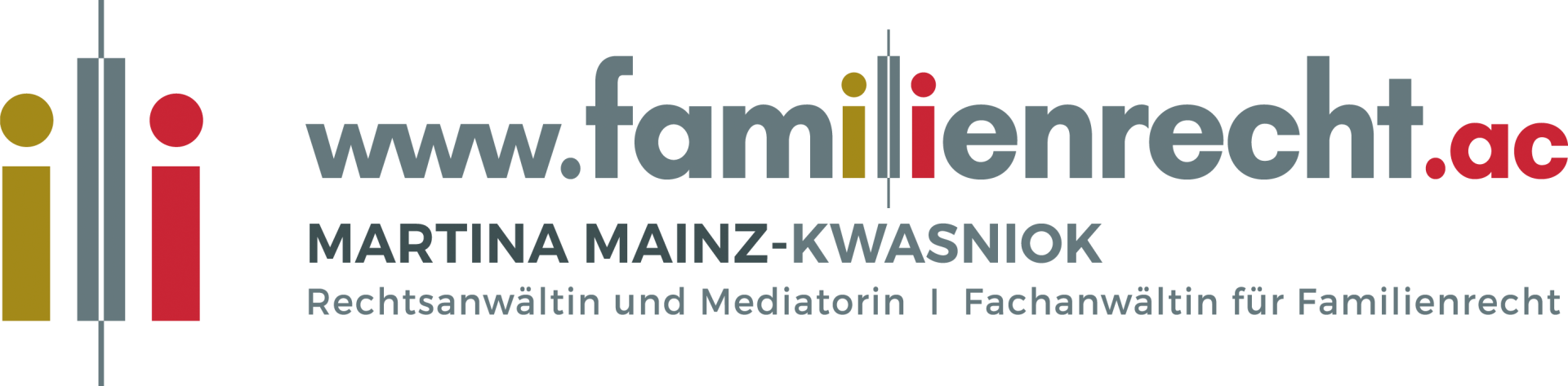Nestmodell
Wo wohnen dann die Eltern?
- Es gibt eine weitere Wohnung, in der die Eltern abwechselnd wohnen, wenn der Andere bei den Kindern im Nest ist. Vorteil: das ist insgesamt preiswert. Diese Wohnung kann sehr klein sein (1-Personen-Appartement), weil die Kinder sich dort nie aufhalten und beide Eltern die Vorteile des großzügigen Wohnens zeitweilig im "Nest" nutzen. Nachteil: Die Eltern benötigen viel Disziplin für die notwendige innerliche Trennungsdistanz. Manchen wird so die Privatsphäre fehlen. Wenn man sich gar nicht mehr "riechen" kann, kann man sich keine Wohnung teilen. Kommen neue Partner ins Spiel, wird es sehr kompliziert. Unter all diesen Gesichtspunkten taugt diese Version des Nestmodells aber vielleicht gut für einen Übergang.
- Jeder Elternteil hat eine eigene weitere Wohnung, es gibt also insgesamt drei Adressen. Vorteil: Jeder Erwachsene hat die notwendige Privatsphäre. Nachteil: Zwei Wohnungen plus Nest sind vielleicht nicht finanzierbar.
- Die Eltern (oder einer) haben neue Partner, bei dem sie wohnen, wenn sie gerade nicht mit der Betreuung der Kinder im Nest dran sind. Vorteil: Es entstehen keine zusätzlichen Wohnkosten.
Erfahrungen mit dem Nestmodell
Ich selbst habe das Nestmodell als Anwältin oder Mediatorin auch schon in passenden Konstellationen begleitet, z.B.:
- Die Familie hatte neben leiblichen Kindern auch Pflegekinder, insgesamt 7 Kinder im Alter von 6 Monaten bis 19 Jahren. Die wirtschaftlichen Verhältnisse ließen nicht zu, dass das große Eigenheim erhalten bleiben konnte, wenn dazu noch eine ausreichend große Wohnung angemietet würde, in der der andere Elternteil wohnen und zumindest den leiblichen Kindern Umgang hätte anbieten können. Man wollte aber auch die Pflegekinder und die leiblichen gar nicht verschieden behandeln, und man wollte auch nicht die Pflegekinder vderlieren. Aufgrund der großen Altersunterschiede waren die Kinder auch gar nicht begeistert von der Idee, Freizeit gemeinsam außerhalb ihres Umfeldes zu verbringen. Dafür waren ihre Interessen und Bedürfnisse zu verschieden. Die Eheleute mieteten eine Strasse weiter ein 1-Zimmer-Appartement an. Sie wechselten sich wochenweise mit dem Wohnen in Haus und Appartement ab. Für eine dritte Wohnung reichte das Geld nicht. Das Pflege-Baby zog anfangs immer mit der Mutter zusammen um, später nicht mehr. Noch später fand der Mann eine neue Freundin, bei der er in seiner nicht-Betreuungs-Woche wohnen konnte, so dass die Mutter das Appartement als ihre eigene Privatsphäre hatte und ihre kinderfreie Woche sehr genoss.
- Die Eltern waren schon länger getrennt, die Kinder wohnten bei der Mutter im "alten Haus" und besuchten den Vater am Wochenende, wo auch seine neue Freundin wohnte. Also erstmal "das Übliche". Dann bekam die Mutter Krebs und hatte etliche längere stationäre Aufenthalte zu bewältigen. Während dieser Phasen zog der Vater zu den Kindern, damit Schulweg, Freundschaften etc. stabil blieb. Auch nachdem der Krebs besiegt war, blieb die Familie dabei, dass die nun verrentete Mutter sich eine Woche im Monat "Auszeit nahm", verreiste, bei ihren Eltern oder Freunden wohnte, und der Vater währenddessen mit den Töchtern im Haus lebte. Aufgrund ihrer existentiellen Erfahrung mit der Krebserkrankung hatte sich für diese Mutter als wichtige Priorität ergeben, dass Töchter und Vater ein Alltagsleben kennen, falls sie stirbt. Alle Kritik an ihm als Erziehungsperson, die sie vorher gespürt hatte, fiel mit der Diagnose von ihr ab, und sie war froh, dass ihre Töchter diesen Vater hatten.
- Beide Eltern arbeiten als Selbständige in einer Branche, in der sie einige Monate des Jahres sehr intensiv beruflich eingespannt sind, dann auch auslandsabwesend. Damit keiner auf seine Karriere verzichten musste, hatten sie die Kinder immer schon abwechselnd betreut und ihre Vollzeit-Projekte nacheinander geplant. Es lag daher nahe, diese Absprache auch nach der Trennung beizubehalten und abwechselnd mit den Kindern in der Familienwohnung zu leben, während der andere sowieso beruflich in Hotels lebte.
- Auch ohne solche besonderen Umstände habe ich mehrere Familien kennengelernt, die sich darauf verständigt haben, dass Mutter und Vater abwechselnd mit / bei ihnen wohnen. Manche Modelle haben sehr langfristig funktioniert, andere nur als Übergangsphase. Wenn sie nicht mehr funktionierten, dann immer, weil sich bei den Eltern etwas änderte (neuer Partner, beruflich, Bedürfnis nach mehr Privatsphäre), nie, weil die Kinder damit unzufrieden gewesen wären - ganz im Gegenteil.
Das Süddeutsche-Magazin hat 2012 über Erfahrungen zweier Familien mit dem Nestmodell berichtet. In den Folgejahren hatte ich schon mehrere Anrufe von Journalisten, die sich über das Nestmodell informieren wollten und Kontakte zu solchen Familien suchten. Ich stelle fest: Das Nestmodell gewinnt allmählich an Aufmerksamkeit! Allerdings handelt es sich häufig um ein fragiles Nachtrennungssystem, deren Protagonisten nicht interessiert an öffentlicher Aufmerksamkeit sind. Manchmal hält dieses Modell auch nur, bis neue Partner auftreten, mit denen man sich ein normales Familienleben wünscht.
Nestmodell lässt sich nicht durch gerichtliche Wohnungszuweisung erzwingen
Eine Wohnungszuweisung nach § 1361b I BGB lässt sich nicht dergestalt vornehmen, dass beide Eltern abwechselnd für konkrete zeitliche Intervalle die bisherige Familienwohnung zur alleinigen Nutzung zugewiesen bekommen. Auch eine Zuweisung an den Elternteil allein, der bereit ist, die gleichmäßige Betreuung der gemeinsamen Kinder im Nestmodell umzusetzen, ist unzulässig.
Oberlandesgericht Brandenburg, Beschluss v. 28.8.2024 – 9 UF 145/24
Nestmodell als gerichtliche Umgangsregelung
Die Anordnung eines Nestmodells ist als Umgangsregelung nach § 1684 BGB theoretisch möglich. Sie dürfte aber nur in den Fällen in Betracht kommen, in denen die Eltern sich grundsätzlich über das Modell einig sind, nur über die konkrete Aufteilung nicht. Außerdem spielen sorgerechtliche Aspekte eine Rolle, wenn gegen den Willen eines Elternteiles die Nest-Wohnung zum Lebensmittelpunkt des Kindes werden soll. Nicht zuletzt wird in Grundrechte eines Elternteiles eingegriffen, dem ein Nestmodell wider Willen aufgezwungen werden soll.
Mehr dazu: Rake in FamRZ 5/2025 S. 317ff.